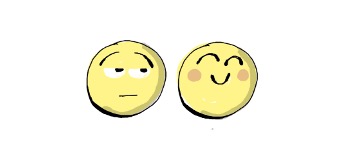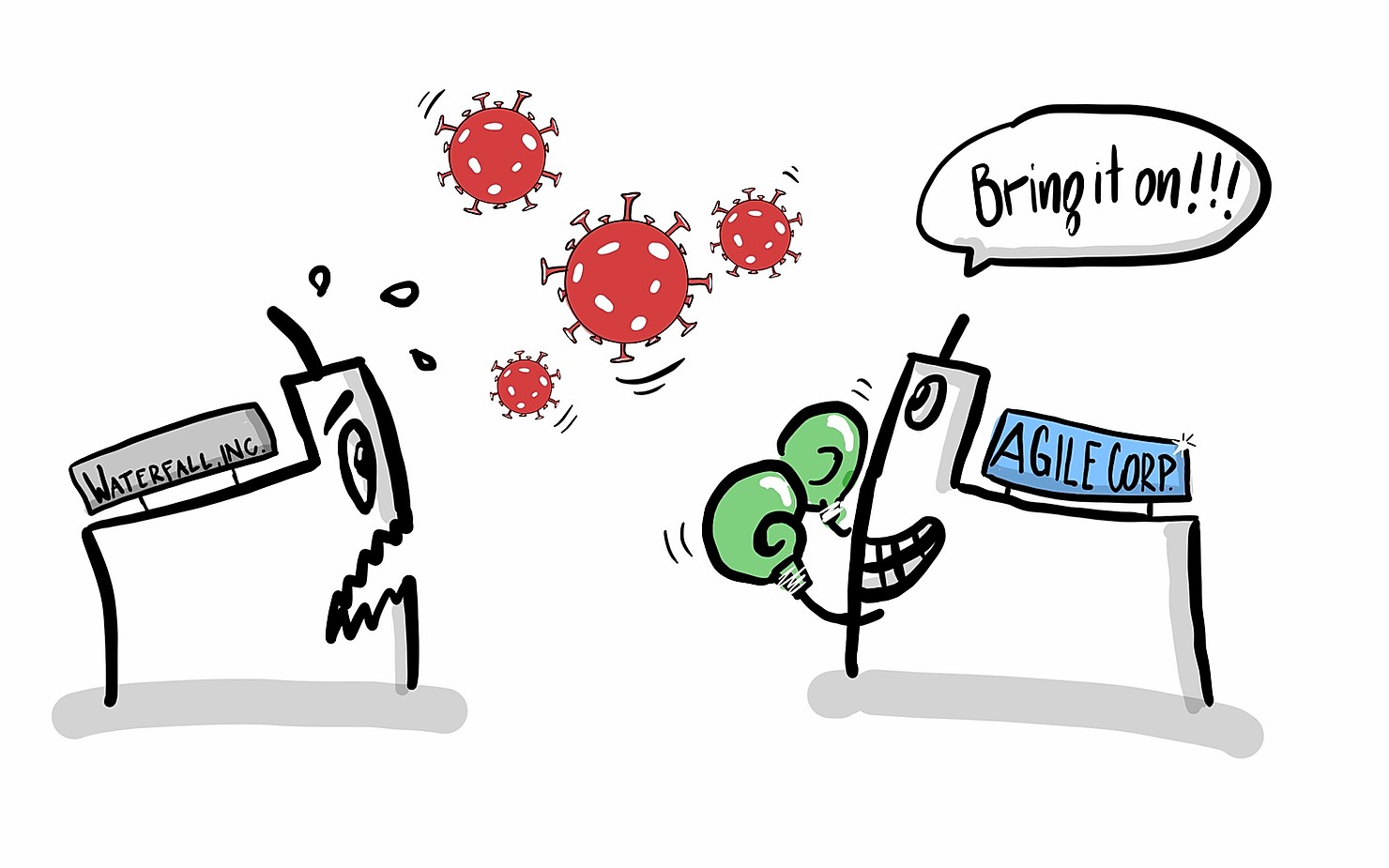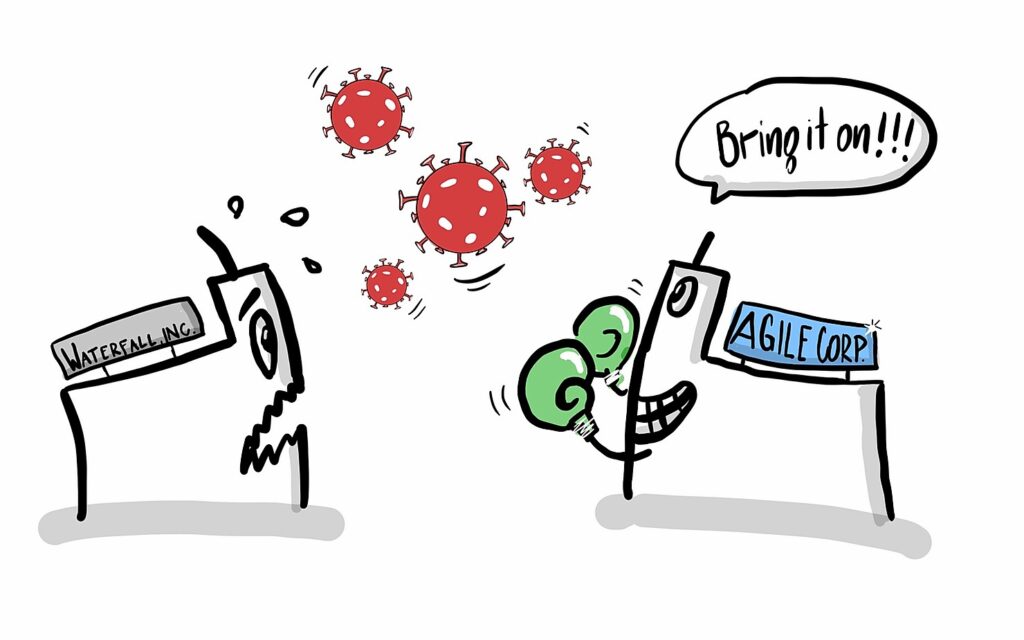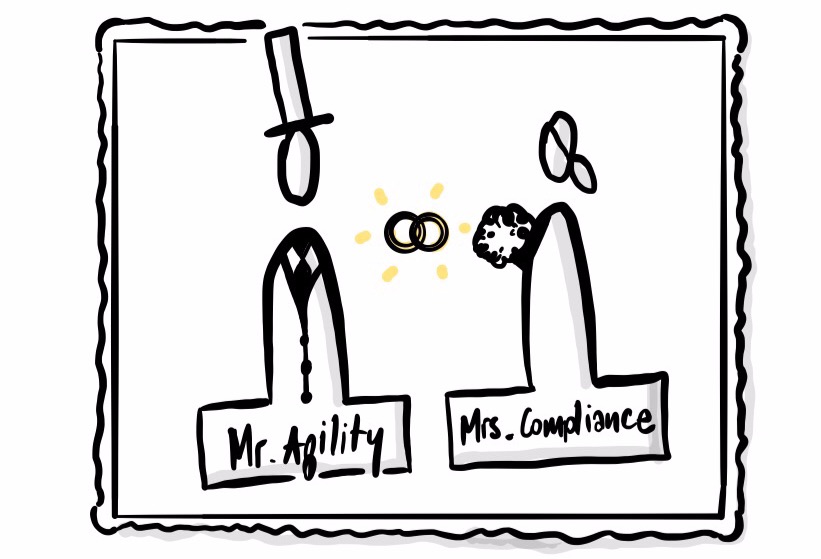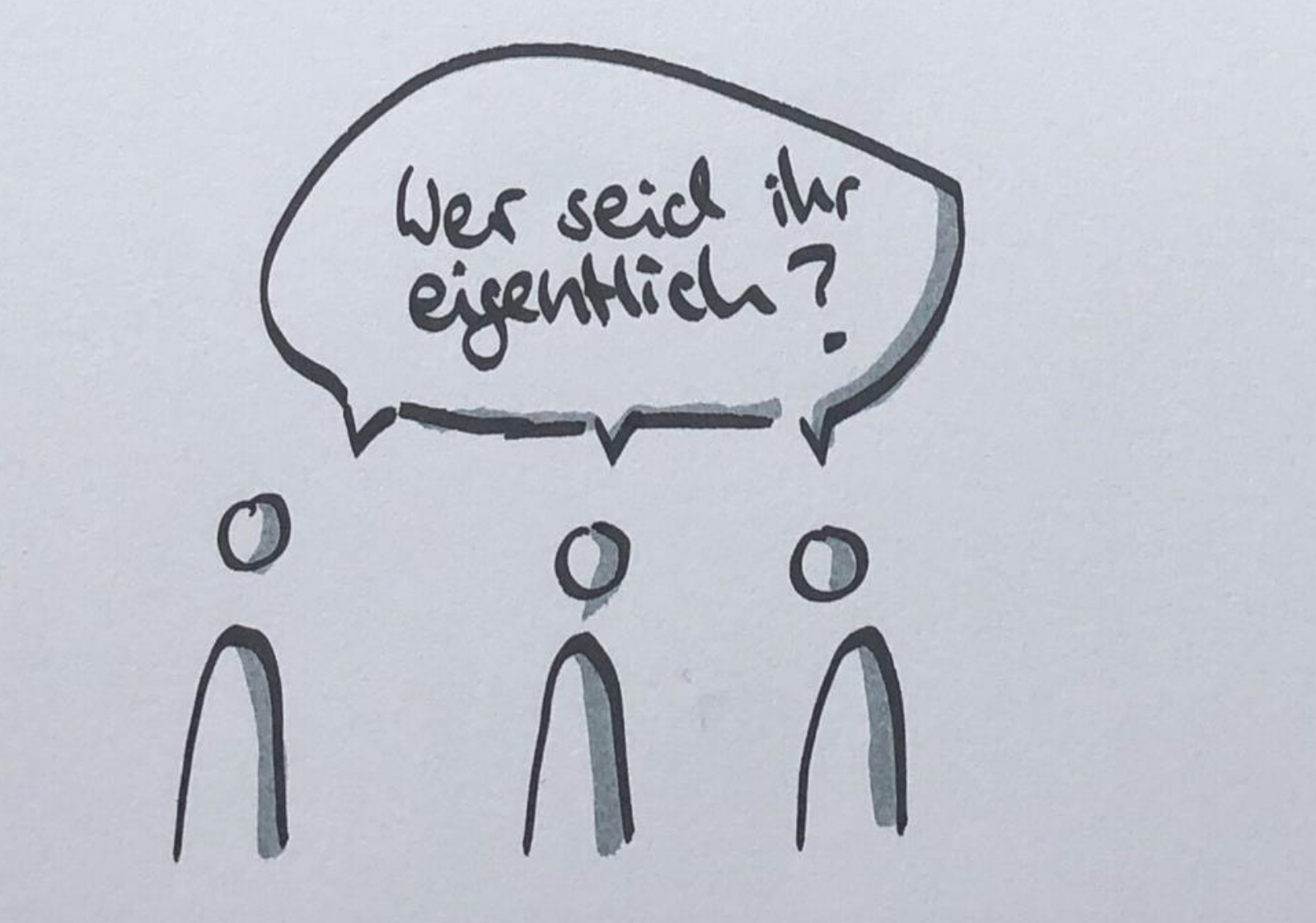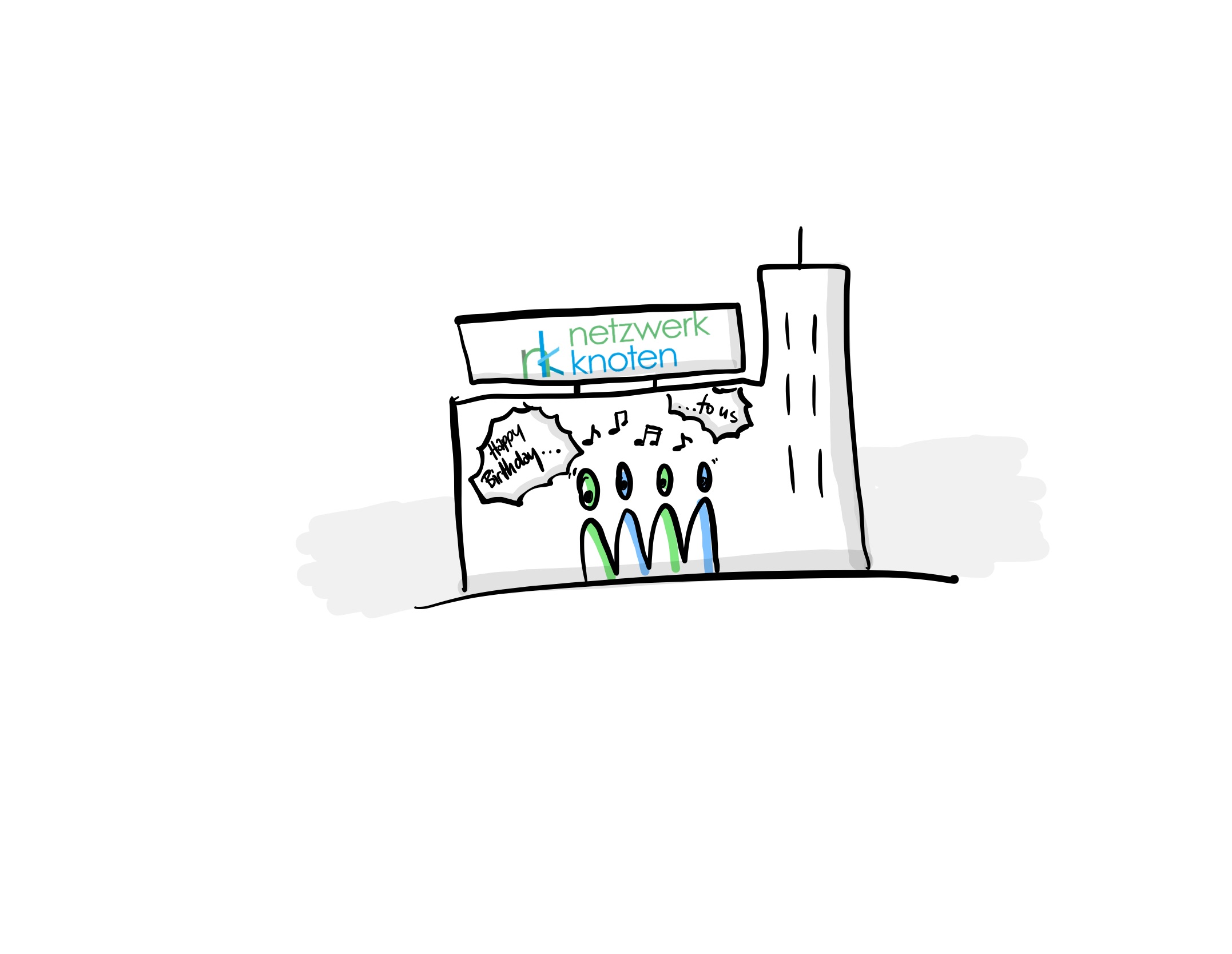(Teil 1) … Eine natürliche Tendenz in Organisationen ist es ja meist, Konflikte entweder nicht zu benennen, um ihnen keine Bühne zu geben und sie somit in ihrer Existenz zu ignorieren. Oder wenn dies nicht gelingt, den Beteiligten zu mehr Entspannung und dem schnellstmöglichen Lösen im 4‑Augen-Gespräch zu raten. Aber dabei bitte die Emotionen rauslassen und lediglich auf einer Sachebene miteinander die Dinge besprechen. Und wenn dies ebenfalls nicht fruchtet, dann versucht man mit großen Workarounds, Lessons-Learned-Meetings und Maßnahmen, einen zukünftigen Ausbruch zu verhindern.
Mit der Strategiearbeit laden sich nun die Organisationen explizit, jedoch ohne es zu wissen, einen oder sogar mehrere Konflikte ein. Sie begeben sich dabei in Zustände der Instabilität und Unsicherheit, mit der Erwartung, dass allein das in der Strategie aufgezeigte und mühsam erarbeitete Bild von der Zukunft genug sei, die Stabilität wieder herzustellen. Und das jedes Mal.
Strategie darf Konflikt sein
In diesen Konfliktsituationen scheint es ok zu sein, dass es ruckelt, dass es für einige unangenehm wird und vor allem, dass es Zeit bedarf, wieder in einen stabilen und damit ruhigen und gestärkten Zustand zu kommen. Wir kommen nicht umhin, uns die Frage zu stellen: Was lässt den Konflikt im Kleid der Strategie so viel sympathischer und akzeptierter erscheinen im Vergleich zu allen anderen Konflikten? Um dem auf die Schliche zu kommen, schauen wir uns erstmal die Gemeinsamkeiten an.
Konflikte haben, wie alles auf der Welt, eine Daseinsberechtigung; obwohl sich bei Stechmücken durchaus die Geister scheiden. Konflikte jedenfalls besitzen immer eine Funktion. Diese ist, sozusagen, ihr Lebenselixier und lässt sie so lange stabil und damit größer, lauter, gewaltiger und eskalativer werden, wie die Funktion noch nach Erfüllung schreit. Was um Himmelswillen kann schon ein Konflikt erfüllen wollen, abgesehen davon die Menschen darin zu verletzen, bloßzustellen und ihre Beziehung zu unterbrechen?
Zum einen sei gesagt, dass dem Konflikt per se erstmal egal ist, wie er sich seine Funktion erfüllt und welche Schmerzen und ungute Gefühle er seiner relevanten Umwelten dabei zukommen lässt (Eidenschink, 2023)*. Für ihn ist erstmal nur wichtig, dass er am Leben bleibt und damit seine Funktion erfüllen kann. In diesem Sinne eigentlich eine feine Eigenschaft: auf ihn ist immer verlass, egal was passiert.
Funktion von Konflikten
Zum anderen brauchen wir in den sozialen Systemen, in denen wir uns alle bewegen, sei es die Familie, die Abteilung, der Verein, die Partnerschaft oder die Gemeinde, dringend die Funktionen, die Konflikte dort herstellen wollen:
Sie wollen entweder eine bestehende Ordnung verteidigen und zeigen das auf, was alles bewahrenswert scheint. Und mit Blick auf die letzte große Veränderungsinitative in Ihrer Organisation, in der eine Handvoll Menschen bunt angemalt durchs Betriebsgelände gelaufen sind und überall erzählt haben, dass das Neue so viel besser ist, ist es wenigstens einer, der sieht, dass in der Vergangenheit nicht alles schlecht war.
Manchmal wollen sie auch einen Status Quo in Frage stellen. Ohne Diskurs darüber fällt es oft schwer zu bemerken, wenn Routinen zu eingeschliffen sind und nicht mehr dem Zweck dienen, oder eine zu große Entspannung eintritt, weil das Gewohnte viel leichter fällt, man aber verpasst, auf die ursprüngliche Zielstellung dessen zu schauen.
Und manchmal streben Konflikte sogar eine Neuordnung an, weil Bestehendes nicht mehr taugt und Altes durch Neues ersetzt werden muss. Veränderung in sozialen wie auch in anderen Systemen und Organismen ist ja die Konstante und damit immer da. Das ist auch gut, denn die Welt da draußen ändert sich so schnell, da ist es sehr dienlich, regelmäßig zu überprüfen, wie man ihr heute am besten begegnen kann — somit auch eine unerlässliche Funktion.
Schlechtes Image von Konflikten
Das gesagt und rational sicher die ein oder andere innerliche Zustimmung erhalten, macht es noch unglaublicher, dass Konflikte in unserem Kulturkreis so unwillkommen sind, wie noch nie zuvor. Mit Blick auf die unzähligen Ratgeber, die eine schnelle Lösung für alle Konflikte anbieten, die Social-Media-Kanäle, die voll sind mit Menschen, die über ein „gesundes“ Mindset einfach alles wegatmen können, und auf die Politikbühne, die Trotz, Beschämung und das Brechen der Gesetze als zulässige Verhaltensweisen akzeptieren, um gesellschaftliche Konflikte zu bewegen, möchte man fast meinen, dass wir vergessen haben, wofür Konflikte eigentlich stehen.
Ja, zugegebenermaßen sind sie hochkomplex, meist undurchsichtig in ihrer Gemengelage und höchstpersönlich in der Bewertung, was es nicht unbedingt leichter macht, ihnen zu begegnen. Sie sind wie Gewitterwolken, neblig und grau aus der Ferne und von Nahem mit ganz vielen einzelnen Wassertropfen versehen. Es braucht daher eine innere Bereitschaft, ausreichend Zeit und Geduld, um sich mit ihren Belangen, den verbundenen Emotionen und auch den sichtbaren und verdeckten Dynamiken auseinanderzusetzen. Und vor allem braucht es Kompetenzen, die über ein Ignorieren, Wegschieben oder blindes Konfrontieren hinaus gehen.
Für all das ist in unserer schnellen, in Hashtags kommunizierenden und nach Wenn-Dann-Lösungen suchenden Welt nicht viel Platz.
Notwendige Kompetenzen
Wer bin ich im Konflikt? Was sind typische Verhaltens- und Sprachmuster von mir in einem Konflikt? Wie reagieren Menschen typischerweise darauf? Wie geht es mir danach? Welche Konflikte gehe ich ein? Vor welchen laufe ich eher weg? Wann gehe ich an die Decke? Wann schotte ich mich ab? Mit wem streite ich und mit wem nicht (Podcastfolge)? Welche Konflikte sind in meiner Organisation willkommen und welche nicht? Wer ist oftmals daran beteiligt und wer nie? Wie baut sich ein Konflikt dort auf und wie verhalten sich die Menschen um ihn herum?
Um auf diese Fragen Antworten zu bekommen, gilt es, sich Zeit zu nehmen, zu beobachten und zu spüren, um mit diesen Erkenntnissen wieder ins Gespräch zu gehen. Erst das Zurückgehen und mit Abstand auf den Konflikt blicken oder das viel näher Rangehen und wirklich Eintauchen in den diffusen Nebel, macht einen Unterschied.
Bei Konflikten in Form einer Strategie sind die Menschen bereitwilliger, diesen Aufwand und die Arbeit zu betreiben. Wie können Konflikte also ihr Image aufpolieren? Und was können sie noch von Strategien lernen? Freut euch auf Teil 3 unserer Blogserie.
Leseempfehlung:
* Eidenschink, Klaus (2023): Die Kunst des Konfliktes — Konflikte schüren und beruhigen lernen
Simon, Fritz B. (2022): Einführung in die Systemtheorie des Konfliktes